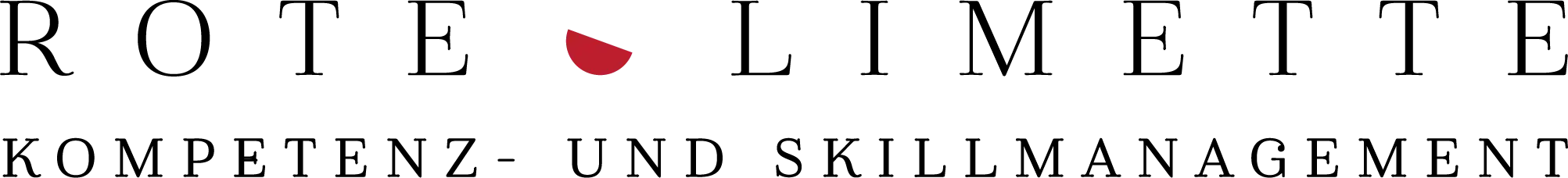Bildungscontrolling im Wandel
Ihr Fahrplan für die CSRD-Berichtspflicht 2025-2028
Die regulatorische Landschaft für Unternehmen in Deutschland und Europa befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Was lange Zeit als „weicher“ Faktor galt – die strategische Entwicklung und Förderung unserer Mitarbeitenden – rückt nun ins Zentrum knallharter, prüfungspflichtiger Berichtsanforderungen. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ist mehr als nur ein weiteres Akronym aus Brüssel; sie ist ein Game-Changer für unser Berufsfeld.
In den kommenden Jahren, von 2025 bis 2028, werden wir Zeugen, wie das Bildungscontrolling von einer internen Steuerungsdisziplin zu einer extern rechenschaftspflichtigen Funktion reift. Dieser Wandel birgt enorme Herausforderungen, aber auch gewaltige Chancen, den strategischen Wert der Personalentwicklung sichtbar und messbar zu machen.
Dieser Artikel ist als Leitfaden durch den Dschungel der neuen Regularien konzipiert. Wir werden detailliert aufschlüsseln, was auf Sie zukommt, welche Kennzahlen (KPIs) entscheidend sind und wie Sie Ihr Bildungscontrolling zukunftssicher aufstellen – illustriert an einem praxisnahen Beispiel eines börsennotierten KMU.
1. Die neue Ära der Transparenz: Was fordert die Regulatorik?
Im Zentrum der neuen Anforderungen steht die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), eine EU-Richtlinie, die die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ablöst und deutlich erweitert. Ihr Ziel ist es, Nachhaltigkeitsinformationen auf eine Stufe mit Finanzkennzahlen zu heben und sie somit transparenter, vergleichbarer und verlässlicher zu machen.
Die CSRD verpflichtet eine wachsende Anzahl von Unternehmen, detailliert über ihre ökologischen, sozialen und Governance-Aspekte (ESG) zu berichten. Für uns im Bildungscontrolling ist dabei vorrangig der soziale Aspekt („S“) von entscheidender Bedeutung.
Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
Die konkreten Inhalte der Berichterstattung werden durch die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) definiert. Diese Standards sind das Herzstück der neuen Berichtspflicht. Für das Bildungscontrolling ist insbesondere der Standard ESRS S1 „Eigene Belegschaft“ relevant. Er fordert von Unternehmen, über ihre Strategien, Maßnahmen und eben auch Kennzahlen in Bezug auf die eigenen Mitarbeitenden zu berichten.
Innerhalb dieses Standards gibt es eine spezifische Angabepflicht, die unsere Arbeit in der Personalentwicklung direkt betrifft:
Angabepflicht S1–13: Kennzahlen für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung.
Diese Angabepflicht verlangt von berichtspflichtigen Unternehmen, quantitative Daten über ihre Weiterbildungsaktivitäten zu veröffentlichen.
Wer ist wann betroffen? Ein gestaffelter Zeitplan:
Die Einführung der CSRD erfolgt schrittweise. Die folgende Tabelle, basierend auf dem Status vom August 2025 und unter Berücksichtigung der sogenannten „Stop the Clock“-Richtlinie, die für einige Unternehmensgruppen eine Verschiebung der Fristen bewirkte, gibt einen Überblick:
| Unternehmensart | Berichtsjahr 2025 (Veröffentlichung 2026) | Berichtsjahr 2026 (Veröffentlichung 2027) | Berichtsjahr 2027 (Veröffentlichung 2028) | Berichtsjahr 2028 (Veröffentlichung 2029) |
| Große Unternehmen (börsennotiert oder nicht, bereits NFRD-pflichtig) | Verpflichtend: Erster CSRD-Bericht Durchschnittliche Schulungsstunden pro Mitarbeiter (nach Geschlecht) Prozentsatz der Mitarbeiter mit regelmäßigen Entwicklungsgesprächen Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 | Verpflichtend: Fortführung der Berichterstattung Gleiche KPIs wie 2025 Benchmarking und Zeitreihenanalyse (freiwillig) Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 | Verpflichtend: Kontinuierliche Berichterstattung Gleiche KPIs wie 2025 Wirksamkeitsberichte (freiwillig) Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 | Verpflichtend: Kontinuierliche Berichterstattung Gleiche KPIs wie 2025 Integration in strategische Planung (freiwillig) Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 |
| Große Unternehmen (nicht NFRD-pflichtig) | Freiwillig: Vorbereitung auf Berichtspflicht Aufbau der Datenerfassung für ESRS S1-13 Orientierung an ISO 30414/30437 Gesetzesgrundlage: Keine (Vorbereitung) | Freiwillig: Systematische Vorbereitung Datenerfassung für ESRS S1-13 Kennzahlen Testläufe der Berichterstattung Gesetzesgrundlage: Keine (Vorbereitung) | Freiwillig: Finale Vorbereitung Vollständige Datenerhebung für ersten Pflichtbericht KPIs nach ESRS S1-13 Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 (Vorbereitung) | Verpflichtend: Erster CSRD-Bericht Durchschnittliche Schulungsstunden pro Mitarbeiter (nach Geschlecht) Prozentsatz der Mitarbeiter mit regelmäßigen Entwicklungsgesprächen Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 Aufgrund „Stop the Clock“-Richtlinie um 2 Jahre verschoben |
| Börsennotierte KMU (kleine und mittlere Unternehmen) | Freiwillig: Orientierung an Kernmetriken 19 Kernmetriken der ISO/TS 30437 Vorbereitung auf künftige Berichtspflicht Gesetzesgrundlage: Keine (freiwillig) | Freiwillig: Datenerhebung Erhebung der ESRS S1-13 Kennzahlen Aufbau der Berichtssysteme Gesetzesgrundlage: keine (Vorbereitung) | Freiwillig: Datenerhebung (nach „Stop the Clock“) Vorbereitung auf Pflichtbericht 2028 KPIs nach ESRS S1-13 Gesetzesgrundlage: keine (Vorbereitung) Ursprünglich verpflichtend, durch „Stop the Clock“ verschoben | Verpflichtend: Erster CSRD-Bericht Durchschnittliche Schulungsstunden pro Mitarbeiter (nach Geschlecht) Prozentsatz der Mitarbeiter mit regelmäßigen Entwicklungsgesprächen Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 Opt-Out-Möglichkeit* bis 2030 |
| Nicht-EU-Unternehmen (mit Niederlassung/Tochter in der EU) | Freiwillig: Vorbereitung empfohlen Orientierung an ESRS-Standards Aufbau der Berichtssysteme Gesetzesgrundlage: keine (Vorbereitung) | Freiwillig: Systematische Vorbereitung Datenerfassung nach ESRS S1-13 Harmonisierung der Konzernberichterstattung Gesetzesgrundlage: keine (Vorbereitung) | Freiwillig: Finale Vorbereitung Vollständige Implementierung der KPI-Erfassung Testberichte nach ESRS S1-13 Gesetzesgrundlage: keine (Vorbereitung) | Verpflichtend: Erster CSRD-Bericht (bei >150 Mio. € EU-Umsatz) Durchschnittliche Schulungsstunden pro Mitarbeiter (nach Geschlecht) Prozentsatz der Mitarbeiter mit regelmäßigen Entwicklungsgesprächen Gesetzesgrundlage: CSRD/ESRS S1-13 |
| Andere kleine Unternehmen (nicht börsennotiert, privat) | Freiwillig: Keine Verpflichtung Eigeninitiative zur Bildungscontrolling-Optimierung Orientierung an ISO 30414 als Best Practice Gesetzesgrundlage: Keine | Freiwillig: keine Verpflichtung Mögliche indirekte Betroffenheit durch Lieferkettenpflichten großer Kunden Freiwillige KPI-Erhebung Gesetzesgrundlage: Keine | Freiwillig: keine Verpflichtung Zunehmende Nachfrage von Geschäftspartnern nach Nachhaltigkeitsdaten Vorbereitung auf mögliche künftige Regulierung Gesetzesgrundlage: Keine | Freiwillig: Keine Verpflichtung Wettbewerbsvorteile durch freiwillige Berichterstattung Orientierung an ESRS-Standards empfohlen Gesetzesgrundlage: Keine |
| Öffentliche Unternehmen/Organisationen (kommunale Betriebe, Hochschulen) | Unterschiedlich: Je nach Größenkriterien Große öffentliche Unternehmen: verpflichtend nach CSRD Andere: freiwillig, internes Controlling empfohlen Gesetzesgrundlage: CSRD (falls Größenkriterien erfüllt) oder keine | Unterschiedlich: Je nach Größenkriterien Große: CSRD-Berichtspflicht Andere: freiwilliges Reporting nach ISO 30414 KPIs: Kosten, Teilnahmequoten, Zufriedenheit Gesetzesgrundlage: CSRD (falls Größenkriterien erfüllt) oder keine | Unterschiedlich: Je nach Größenkriterien Große: kontinuierliche CSRD-Berichterstattung Andere: Ausbau des internen Controllings Benchmarking mit anderen öffentlichen Organisationen Gesetzesgrundlage: CSRD (falls Größenkriterien erfüllt) oder keine | Unterschiedlich: Je nach Größenkriterien Große: kontinuierliche CSRD-Berichterstattung Andere: etabliertes internes Bildungscontrolling Transparenz gegenüber Bürgern und Aufsichtsgremien Gesetzesgrundlage: CSRD (falls Größenkriterien erfüllt) oder keine |
*) Börsennotierte KMU haben eine Opt-Out-Möglichkeit bis zum Geschäftsjahr 2028, müssen also spätestens für dieses Jahr berichten.
2. Die entscheidenden Kennzahlen im Fokus (ESRS S1-13)
Der ESRS S1-13 rückt zwei zentrale, verpflichtende Kennzahlen in den Mittelpunkt des Bildungs-Reportings. Diese sind nicht nur zu erheben, sondern auch nach Geschlecht aufzuschlüsseln, um die Gleichbehandlung und Chancengleichheit zu dokumentieren.
KPI 1: Durchschnittliche Anzahl der Schulungsstunden pro Mitarbeiter
Diese Kennzahl gibt Aufschluss über die generelle Intensität der Weiterbildungsaktivitäten im Unternehmen.
- Definition: Die Gesamtzahl aller absolvierten Schulungsstunden aller Mitarbeitenden, geteilt durch die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden im Berichtszeitraum.
- Berechnungsformel: Durchschnittliche Schulungsstunden = (Summe aller Schulungsstunden) / (Durchschnittliche Mitarbeiterzahl)
- Was zählt als Schulungsstunde? Hierzu gehören alle formellen Weiterbildungsmaßnahmen, sowohl intern als auch extern. Dazu zählen explizit auch verpflichtende Unterweisungen wie Arbeitsschutz, Compliance-Schulungen, Datenschutzschulungen etc. Informelles Lernen „on the job“ wird hier in der Regel nicht erfasst, es sei denn, es ist Teil eines strukturierten Programms.
- Aufschlüsselung: Die Angabe muss getrennt für weibliche, männliche und diverse Mitarbeitende erfolgen.
KPI 2: Prozentsatz der Mitarbeiter mit regelmäßigen Leistungs- und Laufbahnbeurteilungen
Diese Kennzahl beleuchtet, wie systematisch und flächendeckend die Personalentwicklung im Unternehmen verankert ist.
- Definition: Der Anteil der Mitarbeitenden, die im Berichtszeitraum mindestens ein formelles Gespräch zur Leistungs- und/oder Karriereentwicklung mit ihrer Führungskraft hatten.
- Berechnungsformel: Prozentsatz = (Anzahl der Mitarbeiter mit Beurteilung) / (Gesamtzahl der Mitarbeiter) * 100
- Was zählt als Beurteilung? Hier sind formelle, dokumentierte Gespräche gemeint. Das können klassische Jahresgespräche, Entwicklungsdialoge, Zielvereinbarungsgespräche oder ähnliche Formate sein, die explizit die Leistung und die berufliche Weiterentwicklung zum Thema haben.
- Aufschlüsselung: Auch hier ist eine getrennte Ausweisung nach Geschlecht erforderlich.
Freiwillige, aber empfohlene Kennzahlen
Neben den verpflichtenden KPIs legen die ESRS nahe, auch über die Wirksamkeit der Maßnahmen zu berichten. Obwohl dies zunächst freiwillig ist, sollten zukunftsorientierte Bildungscontroller hier bereits Daten sammeln. Die ISO-Norm 30414 für das Human Capital Reporting bietet hierfür exzellente Anhaltspunkte. Sinnvolle ergänzende KPIs könnten sein:
- Schulungskosten pro Mitarbeiter
- Zufriedenheit der Teilnehmenden (Feedback-Scores)
- Lerntransfer-Quote (z. B. durch Vorgesetztenbefragung)
- Interne Besetzungsquote von Führungspositionen
3. Fallstudie: Die „Innovations-AG“ – ein börsennotiertes KMU auf dem Weg zur CSRD-Konformität
Um die anstehenden Aufgaben zu verdeutlichen, betrachten wir ein fiktives Unternehmen: die Innovations-AG.
- Unternehmensprofil: Ein börsennotiertes Technologieunternehmen aus Deutschland.
- Mitarbeiterzahl: 230
- Umsatz: 48 Mio. €
- Bilanzsumme: 41 Mio. €
- Status: Gilt als börsennotiertes KMU.
Gemäß dem Zeitplan muss die Innovations-AG erstmals für das Geschäftsjahr 2028 (mit Veröffentlichung im Jahr 2029) einen CSRD-konformen Bericht vorlegen. Trotz der „Stop the Clock“-Verschiebung ist es fahrlässig, erst Ende 2027 mit den Vorbereitungen zu beginnen. Ein strukturierter Fahrplan ist unerlässlich.
Der Fahrplan für das Bildungscontrolling der Innovations-AG (2025–2028)
Phase 1: 2025 – Analyse und Aufbau der Grundlagen
Das Jahr 2025 steht im Zeichen der Sensibilisierung und der Schaffung der datentechnischen Voraussetzungen.
- Konkrete Arbeitsschritte:
- Projektteam bilden: Das Bildungscontrolling initiiert ein interdisziplinäres Team mit Mitgliedern aus HR, IT, Controlling und der Geschäftsführung. Die Verantwortung für das CSRD-Reporting muss klar zugeordnet werden.
- System-Audit: Welche Daten werden bereits erfasst? Wo? In welchem Format? Eine schonungslose Bestandsaufnahme der vorhandenen HR-Systeme (LMS, Personalverwaltungssoftware, Excel-Listen) ist der erste Schritt.
- Herausforderung: Oft sind Daten dezentral und in unterschiedlichen Formaten gespeichert (z. B. externe Schulungen in Excel-Listen der Abteilungen, Pflichtschulungen im LMS).
- Definitionen schärfen: Das Projektteam muss unternehmensweit gültige Definitionen festlegen: Was ist eine „Schulungsstunde“? Was genau gilt als „regelmäßige Leistungs- und Laufbahnbeurteilung“? Diese Definitionen müssen dokumentiert und kommuniziert werden.
- IT-Anforderungen spezifizieren: Auf Basis des Audits und der Definitionen wird ein Anforderungskatalog für die IT erstellt. Ziel ist eine zentrale, verlässliche Datenquelle. Dies kann die Erweiterung eines bestehenden HR-Systems oder die Einführung einer neuen Softwarelösung sein.
Phase 2: 2026 – Implementierung und Testläufe
2026 ist das Jahr der technischen Umsetzung und der ersten Probeläufe.
- Konkrete Arbeitsschritte:
- Systemimplementierung: Die in 2025 spezifizierte IT-Lösung wird eingeführt. Das bedeutet Datenmigration, Prozessanpassungen und Schulungen für die HR-Mitarbeitenden und Führungskräfte.
- Prozessintegration: Die Datenerfassung muss in die täglichen Abläufe integriert werden.
- Beispiel Schulungsstunden: Jede Schulungsteilnahme (intern/extern, Präsenz/Online) muss systematisch erfasst werden. Dies erfordert eine Schnittstelle vom Learning Management System (LMS) zur zentralen HR-Datenbank. Externe Schulungen, die individuell gebucht werden, müssen über einen standardisierten Prozess (z. B. im Employee Self Service) erfasst werden.
- Beispiel Beurteilungen: Führungskräfte müssen das Stattfinden der Gespräche in einem HR-Tool bestätigen. Der Prozess muss so gestaltet sein, dass er einfach und nachvollziehbar ist.
- Erster Probelauf: Ende 2026 führt das Bildungscontrolling den ersten „Trockenlauf“ für die Berichterstattung durch. Es werden die KPIs für 2026 aufbereitet, um Datenlücken, Prozessschwächen und Fehler in der Berechnungslogik zu identifizieren.
Phase 3: 2027 – Optimierung und finale Vorbereitung
Das vorletzte Jahr vor der Pflicht dient der Feinjustierung und der vollständigen Datenerhebung.
- Konkrete Arbeitsschritte:
- Prozessoptimierung: Basierend auf den Erkenntnissen des Probelaufs werden die Prozesse und Systeme verfeinert. Gibt es Abteilungen, die Daten unvollständig liefern? Ist der Erfassungsprozess für Führungskräfte zu kompliziert?
- Vollständige Datenerhebung: Ab dem 1. Januar 2027 beginnt die „scharfe“ Datenerfassung für den ersten Pflichtbericht. Die Datenqualität wird kontinuierlich (z. B. quartalsweise) überprüft.
- Schulung der Stakeholder: Die Geschäftsführung, Führungskräfte und der Betriebsrat werden über die anstehende Berichtspflicht und die Bedeutung der Datenqualität informiert.
- Erstellung eines Musterberichts: Das Bildungscontrolling erstellt einen vollständigen, aber noch inoffiziellen Bildungsreport für das Geschäftsjahr 2027, um den gesamten Prozess von der Datenerhebung bis zur finalen Darstellung zu simulieren.
Phase 4: 2028 – Der erste Pflichtbericht
Im Jahr 2028 wird es ernst. Die Daten des gesamten Jahres müssen konsolidiert und für den Lagebericht aufbereitet werden.
- Konkrete Arbeitsschritte:
- Finale Datenerhebung und Konsolidierung: Bis Mitte Januar 2029 müssen alle relevanten Daten für 2028 vorliegen.
- Berechnung der KPIs: Die finalen Kennzahlen werden berechnet und nach Geschlecht aufgeschlüsselt.
- Formale Aufbereitung: Die Daten werden in der vorgegebenen Form für den Nachhaltigkeitsbericht aufbereitet. Dies geschieht in enger Abstimmung mit der Abteilung, die für den gesamten CSRD-Bericht verantwortlich ist.
- Prüfungssicherheit herstellen: Alle Prozesse, Definitionen und Berechnungswege müssen sauber dokumentiert sein, da die Nachhaltigkeitsberichterstattung einer externen Prüfung unterliegt.
Prozesshafte und technische Gestaltung
Um der Berichtspflicht nachzukommen, muss die Innovations-AG ihr Bildungscontrolling wie folgt aufstellen:
- Technisch:
- Zentrales HR-System: Ein führendes System (oft ein HR-Informationssystem, HRIS) ist unerlässlich.
- Integriertes Learning-Management-System (LMS): Das LMS sollte automatisch die Stunden für absolvierte E-Learnings und interne Trainings an das HRIS melden.
- Employee/Manager Self-Service (ESS/MSS): Ein Portal, in dem Mitarbeitende extern besuchte Kurse eintragen und Führungskräfte die Durchführung von Entwicklungsgesprächen bestätigen können.
- Reporting-Tool: Ein Business-Intelligence-Tool (BI-Tool), das auf die zentrale Datenbank zugreift und die KPIs automatisiert, standardisiert und auf Knopfdruck auswertbar macht.
- Prozesshaft:
- Klare Verantwortlichkeiten: Wer pflegt welche Daten? Wer prüft die Qualität?
- Standardisierte Workflows: Der Prozess von der Buchung einer Schulung bis zur Erfassung der Stunden muss klar definiert sein.
- Regelmäßiges Monitoring: Das Bildungscontrolling muss die Datenqualität nicht erst am Jahresende, sondern kontinuierlich überwachen.
- Integration in die Unternehmenssteuerung: Die KPIs sollten nicht nur für den Bericht erhoben, sondern auch aktiv für die Steuerung der Personalentwicklung genutzt werden.
4. Vom Datenpunkt zum Bericht: Die formale Darstellung
Die ermittelten Kennzahlen müssen im Nachhaltigkeitsteil des Lageberichts klar und verständlich dargestellt werden. Eine narrative Einordnung ist dabei ebenso wichtig wie die reinen Zahlen. Hier ein fiktives Beispiel, wie die Innovations-AG ihre Ergebnisse für 2028 präsentieren könnte.
Auszug aus dem Nachhaltigkeitsbericht der Innovations-AG 2028
ESRS S1 – Eigene Belegschaft
Angabepflicht S1-13: Weiterbildung und Kompetenzentwicklung
Die Innovations-AG betrachtet die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden als wesentlichen Faktor für unseren Geschäftserfolg und unsere Innovationskraft. Unsere Personalentwicklungsstrategie zielt darauf ab, sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen zu fördern und allen Mitarbeitenden faire Entwicklungschancen zu bieten. Die folgenden Kennzahlen geben Auskunft über unsere Aktivitäten im Berichtsjahr 2028.
Tabelle 1: Durchschnittliche Schulungsstunden pro Mitarbeiter (2028)
| Kategorie | Durchschnittliche Schulungsstunden |
| Gesamt | 28,5 h |
| Weiblich | 30,2 h |
| Männlich | 27,1 h |
| Divers | 29,0 h |
Erläuterung: Die durchschnittliche Anzahl der Schulungsstunden umfasst alle formellen internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen sowie verpflichtende Unterweisungen. Der leichte Vorsprung bei unseren weiblichen Mitarbeitenden ist unter anderem auf eine hohe Teilnahme an unseren Programmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen zurückzuführen.
Tabelle 2: Regelmäßige Leistungs- und Laufbahnbeurteilungen (2028)
| Kategorie | Anteil der Mitarbeiter mit Beurteilung |
| Gesamt | 92 % |
| Weiblich | 93 % |
| Männlich | 91 % |
| Divers | 95 % |
Erläuterung: Der hohe Anteil an Mitarbeitenden, die ein formelles Entwicklungsgespräch erhalten haben, spiegelt die erfolgreiche Implementierung unseres standardisierten Jahresdialogs wider. Die verbleibenden 8 % sind primär auf längere Abwesenheiten (z. B. Elternzeit, Sabbatical) zurückzuführen, wobei die Gespräche in diesen Fällen nach der Rückkehr nachgeholt werden.
5. Fazit: Vom Pflichtprogramm zur strategischen Kür
Die neuen Berichtspflichten im Rahmen der CSRD sind für das Bildungscontrolling in Deutschland eine Zäsur. Der Druck zur Quantifizierung und Standardisierung nimmt massiv zu. Die Jahre 2025 bis 2028 werden für viele Unternehmen, insbesondere für KMU, eine intensive Phase der Vorbereitung, Implementierung und Optimierung sein.
Die Kernaussagen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Es ist keine Option, sondern eine Pflicht: Eine wachsende Zahl von Unternehmen wird gesetzlich gezwungen, über Bildungskennzahlen zu berichten. Ignorieren ist keine Alternative.
- Zwei KPIs sind das Minimum: Die durchschnittlichen Schulungsstunden und der Anteil der Mitarbeitenden mit Entwicklungsgesprächen sind der neue Standard, der nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden muss.
- Daten sind das neue Gold: Ohne eine saubere, zentrale und verlässliche Datenbasis ist die Berichtspflicht nicht zu erfüllen. Investitionen in HR-IT und klare Prozesse sind unumgänglich.
- Vorbereitung ist alles: Auch wenn die Pflicht für viele erst 2028 greift – der Aufbau der Systeme und Prozesse benötigt Zeit. Unternehmen, die jetzt starten, vermeiden teuren und fehleranfälligen Aktionismus in letzter Minute.
Doch sehen wir dies nicht nur als Belastung. Die CSRD bietet dem Bildungscontrolling die einmalige Chance, seine Relevanz zu beweisen. Die Kennzahlen, die wir für den Lagebericht erheben, sind dieselben, die wir benötigen, um den Wertbeitrag der Personalentwicklung gegenüber der Geschäftsführung zu legitimieren.
Nutzen wir diese regulatorische Welle, um unsere Prozesse zu professionalisieren, unsere Systeme zu modernisieren und das Bildungscontrolling endgültig als strategischen Partner im Unternehmen zu etablieren. Es liegen arbeitsreiche, aber auch unglaublich spannende Jahre vor uns. Packen wir es an!
6. Quellenverzeichnis
- CMS Hasche Sigle. (2025, 17. April). „Omnibus“: Reduzierte Nachhaltigkeitspflichten für Unternehmen – Brüsseler Kurskorrektur zur CSRD und Taxonomie-Verordnung. CMS Legal Blog. https://www.cmshs-bloggt.de/rechtsthemen/sustainability/sustainability-corporate-governance-risk-compliance/bruesseler-kurskorrektur-eu-kommission-plant-mit-dem-omnibus-reduzierte-nachhaltigkeitspflichten-fuer-unternehmen-teil-i-csrd-und-taxonomie/
- EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). (2023). ESRS S1 Own Workforce: Implementation Guidelines and Technical Documentation. EFRAG Press. https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_S1.pdf
- Envalor. (2024, 3. Dezember). CSRD-Berichtspflicht für KMU bietet Chancen. https://www.envalor.de/csrd-berichpflicht-fuer-kmu-bietet-chancen/
- Europäische Kommission. (2022). Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014, der Richtlinie 2004/109/EG, der Richtlinie 2006/43/EG und der Richtlinie 2013/34/EU in Bezug auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Amtsblatt der Europäischen Union, L 322/15. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
- Europäische Kommission. (2023, 31. Juli). Delegierte Verordnung (EU) 2023/2772 der Kommission vom 31. Juli 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (European Sustainability Reporting Standards – ESRS S1). Amtsblatt der Europäischen Union, L 2023/2772. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R2772
- Europäische Union. (2025, 16. April). Richtlinie (EU) 2025/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2025 zur Änderung der Richtlinie 2022/2464/EU in Bezug auf die Verschiebung bestimmter Compliance-Daten („Stop-the-Clock“-Richtlinie). Amtsblatt der Europäischen Union, L 2025/794. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32025L0794
- Haufe Verlag. (2024). ESRS S1 Arbeitskräfte des Unternehmens / S1-13 Angabepflicht S1-13: Kennzahlen für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung. In Haufe Personal Office Gold. https://www.haufe.de/id/norm/esrs-s1-arbeitskraefte-des-unternehmens-s1-13-angabepflicht-s1-13-kennzahlen-fuer-weiterbildung-und-kompetenzentwicklung-HI15945440.html
- Husemann. (2025, 3. April). „Stop-the-clock“ – Verschiebung der CSRD-Berichtspflicht für Unternehmen der zweiten Welle. https://www.husemann.de/stop-the-clock-verschiebung-der-csrd-berichtspflicht-fuer-unternehmen-der-zweiten-welle/
- International Organization for Standardization. (2024, März). ISO 30414:2018 – Human resource management — Guidelines for human capital reporting (Deutsche Fassung: DIN ISO 30414:2024-03). ISO Press. https://www.iso.org/standard/69338.html
- Nguyen, T., & Krüger, M. (2024). Betriebliche Weiterbildung als Gegenstand der Nachhaltigkeitsberichterstattung: ESRS S1-13 in der praktischen Umsetzung. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), 48, 24-29. https://www.bwpat.de/ausgabe48/nguyen_krueger_bwpat48.pdf
- Plana Earth GmbH. (2024, 29. Mai). CSRD-Zeitplan: Wann sollte Ihr Unternehmen berichten? Ein praktischer Leitfaden zur schrittweisen Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive. https://plana.earth/de/academy/timeline-csrd
- VERSO. (2025, 16. Januar). CSRD & Arbeitskräfte: Tipps zum Reporting nach ESRS S1 und S2. https://verso.de/wissen/csrd-arbeitskraefte-esrs-s1-s2/
- Wirtschaftsprüferkammer (WPK). (2024). Kernvorschriften der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Leitfaden für deutsche Unternehmen. WPK Verlag. https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Wissen/Nachhaltigkeit/WPK_Nachhaltigkeit_Kernvorschriften_CSRD.pdf
- Wirtschaftsprüferkammer (WPK). (2025, 16. April). Richtlinie zur Verschiebung der Anwendung der neuen EU-Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und zu Sorgfaltspflichten („Stop the Clock“) im Amtsblatt der EU. https://www.wpk.de/news/stop-the-clock-richtlinie-im-amtsblatt-der-eu/