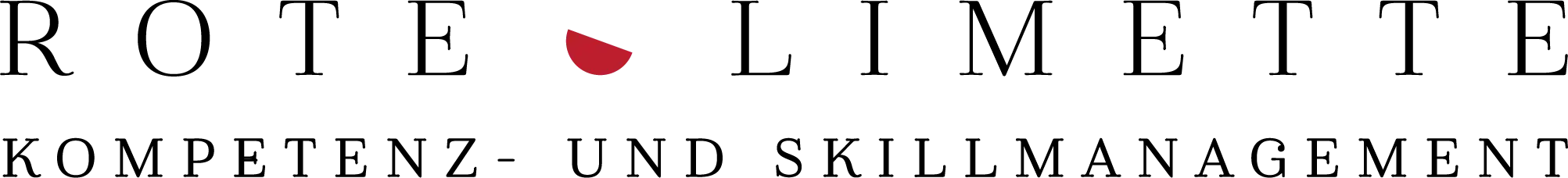Ein Leitfaden für Führungskräfte und HR-Verantwortliche zur rechtssicheren und validen Auswahl der besten Projektpartner für die komplexen Bauvorhaben der Zukunft.
1. Einleitung: Die Revolution im Bauwesen – Integrierte Projektabwicklung (IPA)
Die Prozesse in der Wirtschaft werden komplexer, und mit ihr die Bauvorhaben, die wir zur Gestaltung unserer Zukunft benötigen. Ob es um anspruchsvolle Infrastrukturprojekte, hochmoderne Industrieanlagen oder nachhaltige Energie- und Wasserstraßenprojekte geht – die traditionellen, oft konfrontativen Abwicklungsmodelle stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Terminüberschreitungen, Kostenexplosionen und Rechtsstreitigkeiten sind die allzu bekannten Folgen.
Hier setzt die Integrierte Projektabwicklung (IPA), international auch als Integrated Project Delivery (IPD) oder Project Alliancing bekannt, an. IPA ist mehr als nur eine neue Vertragsform; es ist ein Paradigmenwechsel in der Projektkultur.
Was ist Integrierte Projektabwicklung (IPA)? Im Kern ist IPA ein kooperatives Projektabwicklungsmodell, das darauf abzielt, die Interessen aller wesentlichen Projektbeteiligten – Bauherr, Planer und ausführende Unternehmen – von Beginn an auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Dies geschieht durch:
- Einen Mehrparteienvertrag: Alle Schlüsselpartner unterzeichnen einen einzigen Vertrag, der sie zu einer Projektallianz zusammenschweißt.
- Frühzeitige Einbindung: Die ausführenden Unternehmen werden nicht erst nach Abschluss der Planung, sondern bereits in einer sehr frühen Phase in das Projektteam integriert. Ihre Expertise fließt somit direkt in die Konzeption und Planung ein.
- Gemeinsame Risiken und Chancen: Anstelle von getrennten Risikotöpfen und Gewinnmargen gibt es ein gemeinsames Anreizsystem (Pain/Gain-Share). Der Projekterfolg wird zum gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg aller Partner. Scheitert das Projekt, tragen alle gemeinsam die Konsequenzen.
- Eine Kultur der Kollaboration: Offene Kommunikation, transparente Kosten („Open Book“) und eine lösungsorientierte „Best-for-Project“-Mentalität ersetzen das traditionelle Silodenken und die gegenseitigen Schuldzuweisungen.
Die Zukunft der Bauwirtschaft ist kollaborativ. Die Dynamik ist unübersehbar: In Deutschland nimmt die Zahl der IPA-Projekte seit 2018 stetig zu. Allein für das Jahr 2025 wird mit rund 43 laufenden Vorhaben gerechnet, ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Insbesondere der öffentliche Sektor, allen voran die DB InfraGO und der Bundeshochbau, treiben diesen Wandel voran. Warum? Weil IPA eine vielversprechende Antwort auf die größten Herausforderungen unserer Zeit bietet: mehr Termin- und Kostensicherheit, weniger Reibungsverluste und eine schnellere Lösungsfindung bei hochkomplexen Projekten.
Doch dieses Modell stellt eine zentrale Anforderung, die über allem anderen steht: Es braucht die richtigen Partner.
2. Das Nadelöhr zum Erfolg: Partnerwahl als kritischer Faktor
Der Erfolg eines IPA-Projekts steht und fällt mit der Qualität der Allianzpartner. Während in traditionellen Modellen fachliche Referenzen und der niedrigste Preis oft die entscheidenden Zuschlagskriterien sind, versagen diese Metriken im Kontext von IPA. Ein Unternehmen mag technisch brillant und wirtschaftlich günstig sein, doch wenn seine Kultur nicht auf Kollaboration, Transparenz und gemeinsame Problemlösung ausgerichtet ist, wird es in einer Projektallianz zum Risikofaktor.
Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr nur: „Was kann ein Partner?“, sondern vor allem: „Wie arbeitet ein Partner im Team? Wie geht er mit Konflikten um? Wie agiert er unter Druck? Wie offen kommuniziert er?“
Diese überfachlichen, kooperativen Kompetenzen lassen sich nicht aus Hochglanzbroschüren, Referenzlisten oder Preisangeboten ablesen. Sie müssen beobachtet und erlebt werden. Genau hier kommt das Assessment Center (AC) ins Spiel. Es ist das zentrale Instrument, um die Partnerschaftsfähigkeit von Schlüsselpersonen und Teams realitätsnah und standardisiert zu prüfen.
3. Das IPA-Assessment-Center: Mehr als nur ein Bewerbungsgespräch
Ein Assessment Center im Rahmen einer IPA-Vergabe ist kein klassisches Personalauswahlverfahren. Es ist eine sorgfältig konzipierte Projektsimulation, in der die potenziellen Allianzpartner in ihren zukünftigen Schlüsselrollen interagieren, um gemeinsam komplexe, projekttypische Probleme zu lösen.
Der Zweck des AC ist es, Verhalten sichtbar zu machen. Es geht darum, die Lücke zwischen dem zu schließen, was Unternehmen über sich sagen, und dem, was ihre Teams tatsächlich tun. In strukturierten Übungen werden die Kandidaten mit Szenarien konfrontiert, die die Kernherausforderungen eines IPA-Projekts widerspiegeln:
- Umgang mit Zielkonflikten (z. B. Kosten vs. Qualität),
- Gemeinsame Entwicklung von Zielkosten,
- Entscheidungsfindung im Konsens unter Zeitdruck,
- Lösung von unvorhergesehenen Problemen,
- Kommunikation über Schnittstellen hinweg.
Beobachtet wird dabei nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem der Prozess: Wie wird diskutiert? Wie werden Konflikte gelöst? Wer übernimmt Führung? Wie wird Wissen geteilt? Das AC verlagert den Fokus von der reinen Fachkompetenz auf die erfolgskritische Kooperationskompetenz.
4. Auf sicherem Fundament: Die Kriterien für ein valides und rechtssicheres AC
Ein IPA-Assessment-Center ist eine hochwirksame, aber auch komplexe Methode. Damit die Ergebnisse verlässlich und die Vergabeentscheidung rechtssicher sind, muss das Verfahren zwei fundamentalen Anforderungsbereichen genügen: dem Vergaberecht und der Eignungsdiagnostik.
4.1 Vergaberechtliche Leitplanken
Insbesondere für öffentliche Auftraggeber ist die rechtssichere Gestaltung des Vergabeverfahrens essenziell. Die gute Nachricht: IPA-Modelle und Assessment-Center sind mit dem geltenden Vergaberecht (VOB/A, SektVO) vereinbar und werden bereits erfolgreich praktiziert. Folgende Punkte sind dabei entscheidend:
- AC-Leistungen als Zuschlagskriterien, nicht als Eignungskriterien: Dies ist die wichtigste juristische Weichenstellung. Die Eignungsprüfung (Referenzen, technische Leistungsfähigkeit etc.) findet im vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb statt. Das Assessment Center dient der Bewertung der Angebotsqualität. Die dort gezeigte Kooperationsfähigkeit ist ein qualitatives Zuschlagskriterium (im Sinne des § 122 GWB), kein Eignungskriterium. Personenbezogene Merkmale wie Team- und Konfliktfähigkeit werden somit rechtssicher in die Wertung einbezogen.
- Transparenz und Bekanntmachung: Die Bewertungslogik, die Unterkriterien (z. B. „Konfliktlösung“, „Kommunikation“), deren Gewichtung in der Gesamtwertung (empfohlen werden ca. 20-30 %) und die Verhaltensanker (Beispiele für positives/negatives Verhalten) müssen vorab transparent bekannt gemacht werden.
- Standardisierung und Nicht-Diskriminierung: Alle teilnehmenden Teams müssen die exakt gleichen Übungen unter den exakt gleichen Bedingungen durchlaufen. Die Bewertung muss anhand standardisierter Bögen erfolgen, um eine objektive und diskriminierungsfreie Beurteilung sicherzustellen.
- Dokumentation: Der gesamte Prozess, von den Beobachtungen bis zur finalen Punktevergabe, muss lückenlos und nachvollziehbar protokolliert werden.
4.2 Eignungsdiagnostische Gütekriterien
Damit ein AC nicht nur rechtssicher, sondern auch zuverlässig ist, muss es den wissenschaftlichen Qualitätsstandards der Eignungsdiagnostik genügen. Der Goldstandard hierfür ist die DIN 33430, die den Rahmen für berufsbezogene Eignungsbeurteilungen setzt.
Die zentralen Gütekriterien sind:
- Objektivität: Das Ergebnis muss unabhängig vom Beobachter sein. Dies wird durch standardisierte Übungen, klare Bewertungsanker und geschulte Beobachter erreicht.
- Reliabilität (Zuverlässigkeit): Das Verfahren muss bei Wiederholung zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Gut definierte Merkmale und mehrere Beobachter, die zu einem übereinstimmenden Urteil kommen (Beurteilerübereinstimmung), sind hier entscheidend.
- Validität (Gültigkeit): Das AC muss auch tatsächlich das messen, was es messen soll (z. B. Kooperationsfähigkeit) und dieses Merkmal muss nachweislich für den späteren Projekterfolg relevant sein. Dies erfordert eine saubere Anforderungsanalyse im Vorfeld.
Die Umsetzung dieser Kriterien erfordert qualifizierte Beobachter, eine methodisch saubere Konzeption und eine strenge Trennung von Verhaltensbeobachtung und Bewertung.
5. Der Paradigmenwechsel: Vom „Ich“ zum „Wir“ – Teams statt Individuen bewerten
Die vielleicht größte methodische Herausforderung eines IPA-Assessment-Centers liegt darin, dass wir nicht die Eignung von Einzelpersonen bewerten und hoffen, dass die Summe der Teile ein exzellentes Ganzes ergibt. Wir wissen aus Jahrzehnten der Forschung: Ein Team aus den besten Experten ist nicht zwangsläufig das beste Expertenteam.
Der Fokus der Diagnostik verschiebt sich daher von individuellen Eigenschaften hin zu kollektiven Prozessen und Interaktionen.
Die „Kollektive Intelligenz“ (c-Faktor)
Die Forschung von Woolley et al. (2010) hat gezeigt, dass erfolgreiche Teams eine „kollektive Intelligenz“ (c-Faktor) besitzen, die nur schwach mit der durchschnittlichen Intelligenz der einzelnen Mitglieder korreliert. Stattdessen wird die kollektive Intelligenz maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt:
- Durchschnittliche soziale Sensitivität der Mitglieder: Die Fähigkeit, aus nonverbalen Signalen (wie Mimik oder Tonfall) die Emotionen und Absichten anderer zu erkennen.
- Gleichverteilung der Gesprächsanteile: In erfolgreichen Teams kommen alle Mitglieder zu Wort; es gibt keine Dominanz durch Einzelpersonen.
Diese Erkenntnisse sind für das IPA-AC fundamental. Sie belegen, dass die Messung von Interaktionsmustern und kooperativen Prozessen eine höhere Vorhersagekraft für die Teamleistung hat als die alleinige Betrachtung individueller Kompetenzen.
Teamprozess-Modelle als diagnostischer Rahmen
Um Teaminteraktionen strukturiert zu erfassen, liefert das Teamprozess-Modell von Marks, Mathieu und Zaccaro (2001; s. a. Oostrom, Lehmann-Willenbrock und Klehe (2019)) einen validierten Referenzrahmen. Es unterscheidet drei Phasen von Teamprozessen, die reliabel erfasst werden können:
- Transitionsprozesse (Übergangsphasen): Aktivitäten zwischen den Leistungsphasen, z. B. Auftragsklärung, Zieldefinition, Strategieplanung.
- Aktionsprozesse (Handlungsphasen): Aktivitäten während der eigentlichen Aufgabenerfüllung, z. B. Fortschritts-Monitoring, System-Monitoring, Koordination, gegenseitige Unterstützung.
- Interpersonelle Prozesse: Phasenübergreifende Aktivitäten, die die sozialen Beziehungen im Team steuern, z. B. Konfliktmanagement, Motivations- und Vertrauensbildung, Affektmanagement.
Ein IPA-AC sollte folglich so gestaltet sein, dass es Übungen enthält, in denen genau diese prozessualen Kompetenzen sichtbar und bewertbar werden.
6. Der Werkzeugkasten für die Praxis: Gestaltung des IPA-Assessment-Centers
Wie sehen die Komponenten eines AC aus, das diesen rechtlichen, diagnostischen und methodischen Anforderungen gerecht wird?
6.1 Anforderungsgerechte Übungen
Eignungspsychologisch haben sich teaminteraktive Arbeitsproben mit klarem IPA-Bezug als zentral erwiesen. Statt isolierter Einzelaufgaben stehen Simulationen im Vordergrund, die kollektive Prozesse erfordern:
- Gruppenübung mit Zielkonflikt: Das Team erhält eine komplexe Aufgabe mit widersprüchlichen Zielen (z. B. Einhaltung eines engen Budgets bei gleichzeitig hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen). Hier werden insbesondere die gemeinsame Lösungsfindung und der Umgang mit Interessensdivergenzen beobachtet.
- IPA-Fallstudie zu Zielkosten/Risiken: Das Team muss gemeinsam Zielkosten für ein fiktives Projekt entwickeln oder einen Plan für das gemeinsame Management unvorhergesehener Risiken erstellen. Dies simuliert eine der Kernaufgaben der frühen IPA-Phasen.
- Rollenspiel „kritisches Gespräch“: Eine typische Konfliktsituation aus einem IPA-Projekt wird simuliert (z. B. eine notwendige Zielkostenanpassung, ein signifikanter Änderungsbedarf). Bewertet werden Verhandlungsgeschick, Führung und Konfliktlösungsfähigkeit. Alternativ kann ein strukturiertes, kompetenzbasiertes Interview durchgeführt werden.
- Moderierter Reflexionsworkshop: Nach einer Übung reflektiert das Team unter Moderation seinen eigenen Arbeitsprozess. Hier zeigen sich Lernbereitschaft, Feedbackkultur und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
6.2 Relevante Themenstellungen
Die Inhalte der Übungen sollten– um anforderungsgerecht zu sein– direkt die Kernprozesse der IPA abbilden. Dazu gehören:
- Zielkostenbildung und das „Best for Project“-Prinzip,
- Gemeinsames Risikomanagement und Entscheidungsfindung im Konsens,
- Lean/BIM-basierte Kollaboration und Prozessoptimierung,
- Etablierung einer konstruktiven Fehler- und Lernkultur.
6.3 Zu bewertende Eignungsmerkmale (Kompetenzen)
Die aus der Anforderungsanalyse und dem IPA-Kontext abgeleitete Merkmal-Liste sollte beobachtbare und prognostisch belastbare Verhaltensweisen umfassen. Sie bilden die Grundlage für die standardisierten Beobachtungs- und Bewertungsbögen.
- Kooperationsfähigkeit: Teamorientiertes Problemlösen, aktive Einbindung anderer.
- Konfliktlösungskompetenz: Deeskalation, Finden von Win-Win-Lösungen, konstruktiver Umgang mit Divergenzen.
- Kommunikationsfähigkeit: Transparente Ziel- und Feedbackkommunikation, aktives Zuhören.
- Lern-/Veränderungsbereitschaft: Fehlerakzeptanz, Entwicklungsoffenheit, Fähigkeit zur Selbstreflexion.
- Geteilte Führung/Statusflexibilität (Shared Leadership): Übernahme von Verantwortung, situatives Führen, Zurückstellen des eigenen Egos.
- Zielorientierung/Verantwortungsübernahme: Fokussierung auf das Projektziel, lösungsorientiertes Handeln.
- Integrität/Vertrauenswürdigkeit: Offenheit, Verlässlichkeit.
7. Die Matrix des Erfolgs: Eine beispielhafte Übungs-Merkmals-Matrix
Um die Verbindung zwischen Übungen und zu bewertenden Merkmalen zu systematisieren, dient eine Übungs-Merkmals-Matrix. Sie stellt sicher, dass jedes erfolgskritische Merkmal in mindestens einer Übung beobachtbar ist und bildet die Grundlage für eine valide Auswertung.
| Übung → / Merkmal ↓ | Gruppenübung mit Zielkonflikt | IPA-Fallstudie Zielkosten/Risiko | Interview / Rollenspiel „kritisches Gespräch“ | Moderierter Reflexionssprint |
| Kooperation | X | X | X | X |
| Konfliktlösung | X | X | X | |
| Kommunikation | X | X | X | X |
| Geteilte Führung | X | X | ||
| Lern-/Veränderungsbereitschaft | X | X | X | |
| Zielorientierung/Verantwortung | X | X | X | |
| Integrität | X | X |
8. Fazit: Ein unverzichtbares Instrument für zukunftsfähige Bauprojekte
Die Integrierte Projektabwicklung ist der Schlüssel zur Bewältigung der komplexen Bauvorhaben der Zukunft. Ihr Erfolg hängt jedoch von einer radikalen Abkehr von alten Denkmustern und einer Hinwendung zu echter Kollaboration ab. Diese kollaborative Eignung kann nicht auf dem Papier nachgewiesen werden – sie muss in der Praxis demonstriert werden.
Das Assessment Center ist hierfür das maßgeschneiderte, valide und rechtssichere Instrument. Es ist weit mehr als ein Auswahlverfahren; es ist der erste Baustein der Allianz-Kultur und eine Investition in die wichtigste Ressource eines jeden Projekts: die vertrauensvolle und leistungsstarke Zusammenarbeit der Partner.
Für Führungskräfte und HR-Verantwortliche bedeutet dies:
- Strategische Notwendigkeit: Die Implementierung von IPA-Assessment-Centern ist kein „Nice-to-have“, sondern eine strategische Notwendigkeit zur Risikominimierung und Erfolgssicherung.
- Professionalität ist entscheidend: Die Konzeption und Durchführung erfordert eine enge Zusammenarbeit von Vergaberechtsexperten, Eignungsdiagnostikern (z. B. Wirtschaftspsychologen) und IPA-erfahrenen Beratern.
- Investition, die sich auszahlt: Der Aufwand für ein professionelles AC ist im Vergleich zu den potenziellen Kosten, die durch eine schlecht funktionierende Allianz entstehen, verschwindend gering. Es ist die beste Versicherung gegen Projektkrisen.
Indem Sie die richtigen Partner auf den Prüfstand stellen, legen Sie nicht nur den Grundstein für ein einzelnes erfolgreiches Projekt, sondern auch für eine zukunftsfähige, partnerschaftliche und leistungsstarke Bauwirtschaft.
Quellenverzeichnis
Bi-Medien. (2024). IPA in Deutschland: Mehr Vertrauen, Kooperation und Deutschlands Bauprojekte neu gedacht. Abgerufen von https://bi-medien.de/fachzeitschriften/baumagazin/wirtschaft-politik/ipa-modell-deutschlands-bauprojekte-neu-gedacht-b20035
Bundesrechnungshof. (2025). Partnerschaftliche Projektabwicklungsmodelle für große Bauprojekte des Bundes: Chancen und Risiken von Mehrparteienverträgen. Abgerufen von https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Berichte/2025/mehrparteienvertraege-volltext.pdf?_blob=publicationFile&v=2
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. (2023, Mai). POSITION: Integrierte Projektabwicklung – Anregungen der BAUINDUSTRIE für eine breitere Marktakzeptanz. Abgerufen von https://www.bauindustrie.de/fileadmin/bauindustrie.de/Media/Veroeffentlichungen/PosPap_Integrierte-Projektabwicklung_final.pdf
IPA-Zentrum. (2022). Integrierte Projektabwicklung (IPA) – Charakteristika und konstitutive Modellbestandteile. https://ipa-zentrum.de/wp-content/uploads/2023/06/IPA-Charakteristika-und-konstitutive-Modellbestandteile-2022.pdf
IPA-Zentrum. (2024b, Juli). IPA-Report 2024. Abgerufen von https://ipa-zentrum.de/wp-content/uploads/2024/07/IPA-Report-2024.pdf
IPA-Zentrum. (2024c, Oktober). ENDBERICHT | Partnerauswahl und Teambuilding in der Integrierten Projektabwicklung (IPA). Abgerufen von https://ipa-zentrum.de/wp-content/uploads/2024/10/endbericht.pdf
Marks, M. A., Mathieu, J. E., & Zaccaro, S. J. (2001). A temporally based framework and taxonomy of team processes. Academy of Management Review, 26(3), 356–376. https://doi.org/10.2307/259182
Mathieu, J. E., Luciano, M. M., D’Innocenzo, L., Klock, E. A., & LePine, J. A. (2020). The development and construct validity of a team processes survey measure. Organizational Research Methods, 23(3), 399–431. https://doi.org/10.1177/1094428119840801
Oostrom, Janneke K.; Lehmann-Willenbrock, Nale; and Klehe, Ute-Christine (2019). A New Scoring Procedure in Assessment Centers: Insights from Interaction Analysis. Personnel Assessment and Decisions, (5), Iss. 1, Article 5, 73-82. https://doi.org/10.25035/pad.2019.01.005
Riedl, C., Kim, Y. J., Gupta, P., Malone, T. W., & Woolley, A. W. (2021). Quantifying collective intelligence in human groups. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(21), e2005737118. https://doi.org/10.1073/pnas.2005737118
Sackett, P. R., Zhang, C., Berry, C. M., & Lievens, F. (2021). Revisiting meta-analytic estimates of validity in personnel selection: A practical guide. Abgerufen von https://gwern.net/doc/statistics/meta-analysis/2021-sackett.pdf
Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups. Science, 330(6004), 686–688. https://doi.org/10.1126/science.1193147