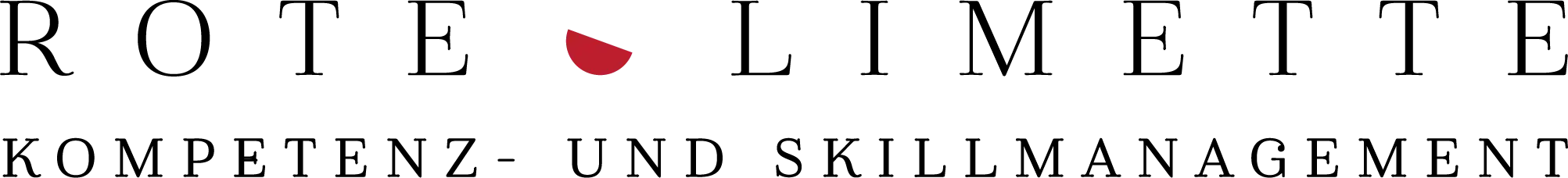Vom Nebel zur Klarheit
Wie strategisches Skills Mapping die Zukunft von KMUs sichern kann
Die tickende Zeitbombe in deutschen Unternehmen
Stellen Sie sich vor, Sie navigieren ein hochmodernes Schiff durch einen aufziehenden Sturm, aber Ihre Instrumente sind veraltet und ungenau. Sie wissen, dass Sie eine fähige Crew an Bord haben, aber Sie wissen nicht genau, wer das Schiff bei extremem Wellengang steuern, wer die komplexen Maschinen reparieren oder wer bei einem Notfall die Rettungsmaßnahmen koordinieren kann. Eine beunruhigende Vorstellung, nicht wahr?
Genau in dieser Lage befinden sich heute unzählige Unternehmen. Eine aktuelle, im Frühjahr 2025 veröffentlichte, internationale Studie des renommierten Software-Unternehmens Workday, „The Global State of Skills“, zeichnet ein alarmierendes Bild:
- 51 % der Führungskräfte sind besorgt über einen zukünftigen Fachkräftemangel.
- Nur 32 % glauben fest daran, dass die heutigen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter für den zukünftigen Erfolg ausreichen werden.
- Und der vielleicht schockierendste Wert: Lediglich 54 % der befragten Führungskräfte geben an, überhaupt einen klaren Überblick über die in ihrer Organisation vorhandenen Skills zu haben.
Diese Zahlen sind mehr als nur Statistiken; sie sind ein Weckruf. In einer Welt, die von künstlicher Intelligenz, rapiden technologischen Umbrüchen und demografischem Wandel geprägt ist, wird die Ungewissheit über die eigenen Kompetenzen und Skills zur größten strategischen Bedrohung. Das traditionelle „Bauchgefühl“ in der Personalarbeit, so charmant es auch sein mag, reicht nicht mehr aus. Es ist an der Zeit, das Licht anzuschalten.
Dieser Artikel zeigt am Beispiel eines fiktiven, aber typischen deutschen Medizintechnik-Unternehmens, wie der Weg aus dem strategischen Nebel gelingen kann – durch die systematische Einführung eines Skill- und Kompetenzmanagements, das Transparenz schafft, Potenziale aufdeckt und das gesamte Unternehmen zukunftsfähig macht.
Fallstudie: Das Dilemma der „MedTech GmbH (Heilbronn)“
Die Heilbronner MedTech GmbH ist ein klassischer „Hidden Champion“ des deutschen Mittelstands. Mit weltweit rund 820 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen hochkomplexe chirurgische Navigationssysteme. Aufgrund der exzellenten Qualität, die international Anerkennung findet, ist das Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren rapide gewachsen. Dabei wurden jedoch notwendige Managementinstrumente und Maßnahmen zur Organisationsentwicklung vernachlässigt.
Der Sitz in Heilbronn, einer Region mit starker industrieller Tradition und hoher Innovationskraft, war lange ein Garant für Erfolg. Doch in den letzten Jahren hat sich das Blatt gewendet – der Sturm des Wandels hat das Unternehmen voll erfasst.
Die Schmerzpunkte sind vielfältig und miteinander verknüpft:
- Recruiting im Blindflug: Die Personalabteilung findet kaum noch passende Kandidaten. Die ausgeschriebenen Stellenprofile sind oft unklar und scheinen die richtigen Talente nicht anzusprechen. Teure Fehlbesetzungen häufen sich.
- Verunsicherte Belegschaft: Die Mitarbeiter spüren den Wandel. Sie sehen, wie sich Technologien wie KI und Robotik auf ihre Arbeit auswirken, wissen aber nicht, welche Fähigkeiten sie morgen benötigen werden. Die angebotenen „Gießkannen“-Weiterbildungen verfehlen oft ihre Wirkung und frustrieren sowohl Mitarbeiter als als auch Führungskräfte.
- Versteckte Potenziale, unentdeckte Risiken: Die Geschäftsführung ahnt, dass in der Belegschaft ungenutzte Talente schlummern. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass Schlüsselpersonen mit kritischem, aber undokumentiertem Wissen das Unternehmen verlassen könnten, was ganze Projekte gefährden würde.
- Ineffiziente Personalprozesse: Jährliche Mitarbeitergespräche sind oft subjektiv und wenig zielführend. Entscheidungen über Beförderungen und Gehaltsentwicklungen basieren mehr auf Sympathie und „gefühlter“ Leistung als auf transparenten, nachvollziehbaren Kriterien.
Die Geschäftsführung der MedTech GmbH erkennt, dass sie an einem Wendepunkt steht. Ein „Weiter so“ ist keine Option. Es wird die strategische Entscheidung getroffen, ein unternehmensweites, systematisches Skillmanagement einzuführen. Das zentrale Werkzeug dafür: ein umfassendes Skills Mapping, das endlich Licht ins Dunkel der vorhandenen und benötigten Fähigkeiten bringen soll.
Das Fundament: Der feine, aber entscheidende Unterschied zwischen „Skill“ und „Kompetenz“
Bevor die MedTech GmbH ihr Projekt startete, musste eine gemeinsame Sprache geschaffen werden. Denn oft werden die Begriffe „Skill“ und „Kompetenz“ synonym verwendet, was zu erheblichen Missverständnissen führen kann. Basierend auf etablierter Fachliteratur (vgl. Kauffeld & Paulsen, 2018) legte das Projektteam klare Definitionen fest:
- Ein Skill (Fertigkeit) ist eine spezifische, erlernbare Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Er ist das „Was“ der Arbeit.
- Beispiele: C++ programmieren, ein EKG lesen, eine CNC-Maschine bedienen, eine Bilanz erstellen.
- Eine Kompetenz ist eine breitere, übergeordnete Fähigkeit, die eine Kombination aus Wissen, Skills, Einstellungen und Verhaltensweisen darstellt, um in komplexen Situationen erfolgreich zu handeln. Sie ist das „Wie“ der Arbeit.
Um die Kompetenzen zu strukturieren, orientierte sich das Team an den bewährten vier Kompetenzbereichen in der deutschsprachigen Berufs- und Wirtschaftspädagogik:
- Fachkompetenz: Das „Was“ – berufs- und aufgabenspezifisches Wissen und Können.
- Methodenkompetenz: Das „Wie“ – die Fähigkeit, Fachwissen flexibel anzuwenden (z. B. analytisches Denken, Projektmanagement).
- Sozialkompetenz: Die Fähigkeit, mit anderen zu interagieren und zu kooperieren (z. B. Teamfähigkeit, Kommunikation).
- Selbstkompetenz: Die Fähigkeit, die eigene Person und Entwicklung im Arbeitskontext zu gestalten (z. B. Lernbereitschaft, Belastbarkeit).
Skills Mapping und Kompetenz-Mapping sind somit zwei Seiten derselben Medaille. Skills Mapping erfasst die granularen Fertigkeiten, während Kompetenz-Mapping die übergeordneten, strategischen Fähigkeiten bewertet. Für ein ganzheitliches Bild sollten beide Ebenen betrachtet werden.
Die Architektur des Erfolgs: Ein hybrides Kompetenzmodell
Für die Heilbrunn MedTech GmbH war klar: Ein reines „One-size-fits-all“-Modell würde nicht funktionieren. Man entschied sich für einen pragmatischen, hybriden Ansatz, der wissenschaftliche Fundierung mit unternehmensspezifischer Praxis verbindet.
Überfachliche Kompetenzen: Das „Great Eight“-Modell von Prof. Dave Bartram
Für die Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen – also die Fähigkeiten, die für alle Mitarbeiter relevant sind – wollte man das Rad nicht neu erfinden. Die Wahl fiel auf das international anerkannte und wissenschaftlich validierte „Great Eight“-Kompetenzmodell von Prof. Dave Bartram (2005). Dieses Modell ist ideal, da es auf beobachtbarem Verhalten basiert und eine klare, hierarchische Struktur bietet:
- 8 Kompetenzfaktoren (die „Great Eight“): z. B. „Führen und Entscheiden“, „Analysieren und Interpretieren“, „Anpassen und Bewältigen“.
- 20 Kompetenzdimensionen: Jeder Faktor wird in 2-3 Dimensionen unterteilt, z. B. wird „Analysieren und Interpretieren“ zu „Schriftliche Kommunikation“, „Einsatz von Fachwissen“ und „Analyse“.
- 112 Kompetenzkomponenten (Skills): Jede Dimension wird durch konkrete Verhaltensanker bzw. Skills beschrieben, z. B. „Informationen analysieren u. bewerten“ oder „Systemisches Denken einsetzen“.
Dieser strukturierte Katalog bot eine exzellente, fundierte Basis für rund 75 % des Kompetenzmodells.
Fachliche Kompetenzen: Die Bildung von „Job Families“
Für die hochspezifischen Fachkompetenzen war ein anderer Ansatz nötig. Hier setzte das Projektteam auf interne Expertise. In einer Reihe von moderierten Workshops mit Führungskräften und Fachexperten aus allen Unternehmensbereichen wurden logische „Job Families“ gebildet.
Beispiele für Job Families bei der MedTech GmbH:
- Kaufmännische Verwaltung & Finanzen
- Produktion & Technik
- Regulatory Affairs & Quality Management
- R&D – Hardware & Implants
- R&D – Software & Navigation
- Vertrieb & Marketing
- IT & Digitales
Für jede dieser „Job Families“ wurden in den Workshops die 3-5 erfolgskritischsten Fachkompetenzen und -skills definiert und in der Unternehmenssprache formuliert. So wurde sichergestellt, dass das Modell nicht nur theoretisch fundiert, sondern auch praktisch relevant ist und von allen verstanden wird.
Das Projekt in der Praxis: In 5 Phasen zu voller Transparenz
Mit den definierten Modellen startete das eigentliche Mapping-Projekt, das in fünf klare Phasen unterteilt wurde.
Phase 1: Das „Soll“-Profil definieren (Die Zielvorgabe) Zuerst musste für jede Rolle im Unternehmen ein klares Anforderungsprofil („Soll“) erstellt werden. Basierend auf den Job Families und dem Great-Eight-Modell definierte das Projektteam gemeinsam mit den Führungskräften, welche Kompetenzen und Skills für eine bestimmte Stelle in welchem Ausprägungsgrad (z. B. 1 = Grundkenntnisse, 2 = Fortgeschritten, 3 = Experte, 4 = Leitender Experte) erforderlich sind. Diese Profile wurden in einer zentralen HR-Software hinterlegt.
Phase 2: Das „Ist“-Profil erheben (Die Bestandsaufnahme) Dies war der kritischste Teil. Um ein objektives Bild („Ist“) zu erhalten, wurde ein Multi-Rater-Ansatz über die Softwareplattform gewählt:
- Selbsteinschätzung der Mitarbeiter: Jeder Mitarbeiter bewertete sich selbst auf den für seine Rolle relevanten Skalen.
- Fremdeinschätzung durch die Führungskraft: Die direkte Führungskraft gab ihre Einschätzung ab.
- Optionales Peer-Feedback: In einigen Teams wurde zusätzlich Feedback von Kollegen eingeholt.
Die Software führte die verschiedenen Bewertungen zusammen und sorgte für einen anonymisierten und fairen Prozess, was die Akzeptanz im Unternehmen massiv erhöhte.
Phase 3: Analyse & Visualisierung – Die Macht der „Heatmap“ Der Moment der Wahrheit. Die Software verglich automatisch die „Soll“- und „Ist“-Profile und visualisierte die Ergebnisse in Form von Kompetenz-Heatmaps. Diese Heatmaps zeigen auf einen Blick, wo die Stärken und wo die Lücken liegen – sowohl für einzelne Mitarbeiter als auch für ganze Teams oder Abteilungen.
- Grün: Kompetenz/Skill ist stärker ausgeprägt als erforderlich (Potenzial für Mentoring).
- Gelb: Kompetenz/Skill entspricht den Anforderungen.
- Rot: Eine Lücke (Gap) zwischen Anforderung und vorhandener Ausprägung (Bedarf für Entwicklung).
Phase 4: Die Ergebnisse nutzen – Von Daten zu Taten Die Heatmaps waren kein Selbstzweck. Sie wurden zur Grundlage für eine Revolution der Personalprozesse:
- Mitarbeitergespräche: Statt subjektiver Bewertungen diskutierten Mitarbeiter und Führungskräfte nun datenbasiert über Stärken, Entwicklungspotenziale und konkrete nächste Schritte.
- Personalentwicklung: Das Gießkannenprinzip wurde beerdigt. Trainingsbudgets flossen nun gezielt in Maßnahmen, die die „roten“ Felder auf der Heatmap adressierten.
- Recruiting: Bei Neubesetzungen konnte die Software gezielt Mitarbeiter identifizieren, deren Skill-Profil bereits gut auf die offene Stelle passte. Beim externen Recruiting konnten nun mittels „Skills-Based Interviewing“ viel präziser Stärken und Entwicklungsbereich von Bewerbern/-innen ermittelt werden.
Phase 5: Integration und kontinuierliche Pflege Das Projekt war kein einmaliges Ereignis. Die Kompetenzprofile wurden fest in die HR-Systeme integriert. Bei einem Strategiewechsel im Unternehmen wurde die Ausrichtung der „Soll“-Profile nachjustiert. Die jährlichen Mitarbeitergespräche dienen nun als fester Ankerpunkt, um die „Ist“-Profile zu aktualisieren und sicherzustellen, dass das System „lebt“ und die Realität im Unternehmen widerspiegelt.
Die neue Transparenz: Ein Team unter dem Mikroskop
Um die gewonnene Transparenz zu veranschaulichen, betrachten wir das 10-köpfige Team „R&D – Software & Navigation“ bei der MedTech GmbH. Vor dem Projekt wusste die Teamleitung zwar, wer „gut“ und wer „schwächer“ war, aber die genauen Stärken und Entwicklungsbereiche blieben im Verborgenen. Nach dem Skills Mapping bot die Software folgende (vereinfachte) Ansicht:
| Mitarbeiter | Rolle | Fachskill: C++ (Soll: 3) | Fachskill: Bildverarbeitung (Soll: 2) | Überfachlich: Analysieren & Interpretieren (Soll: 3) |
| M. Schmidt | Teamleiter | 🟢 (4) | 🟢 (3) | 🟢 (4) |
| A. Huber | Senior Dev. | 🟡 (3) | 🟢 (3) | 🟡 (3) |
| S. Bauer | Senior Dev. | 🟡 (3) | 🟡 (2) | 🔴 (2) |
| F. Wagner | Developer | 🔴 (2) | 🔴 (1) | 🔴 (2) |
| J. Keller | Developer | 🔴 (2) | 🟢 (3) | 🟡 (3) |
| K. Franke | Werkstudent | 🔴 (1) | 🔴 (1) | 🔴 (1) |
| T. Kurz | Architect | 🟢 (4) | 🟢 (4) | 🟢 (4) |
| L. Mayr | UI/UX Expert | 🔴 (1) | 🟡 (2) | 🟢 (4) |
| C. Wolf | Junior Dev. | 🔴 (2) | 🔴 (1) | 🔴 (2) |
| P. Neumann | Tester | 🔴 (1) | 🟡 (2) | 🟡 (3) |
(Legende: 🟢 Stärke/Übererfüllung | 🟡 Anforderung erfüllt | 🔴 Lücke/Entwicklungsbedarf)
Die Erkenntnisse aus dieser einfachen Tabelle waren unmittelbar praxisrelevant:
- Gezieltes Mentoring: Man erkannte sofort, dass Herr Kurz und Herr Schmidt (🟢) ideale Mentoren für die Entwickler mit C++-Schwächen (🔴) sind. Frau Keller (🟢) wurde zur Ansprechpartnerin für das Thema Bildverarbeitung ernannt.
- Teamweite Trainings: Fast das gesamte Entwicklerteam zeigte Lücken in C++. Statt Einzelmaßnahmen wurde ein gezielter, teamweiter C++-Workshop für Fortgeschrittene geplant.
- Versteckte Experten: Frau Keller, eine „normale“ Entwicklerin, entpuppte sich als Expertin in Bildverarbeitung, ein für das Team kritisches Feld. Ihre Rolle im Team wurde aufgewertet.
- Objektive Entwicklungspläne: Für die Mitarbeiter mit roten Feldern (z. B. Herr Wagner, Frau Franke) konnten nun ganz konkrete, messbare Entwicklungsziele für das nächste Jahr vereinbart werden.
Fazit: Eine Investition, die sich mehr als auszahlt.
Die Einführung eines strategischen Skillmanagements war für die MedTech GmbH weit mehr als nur ein weiteres HR-Projekt. Es war eine fundamentale Transformation von einer reaktiven, auf Bauchgefühl und formalen Abschlüssen basierenden Personalpolitik hin zu einer proaktiven, datengestützten und strategischen Unternehmenssteuerung.
Der Weg war nicht immer einfach und erforderte ein klares Bekenntnis der Führungsebene sowie die Bereitschaft zur Veränderung im ganzen Unternehmen. Doch das Ergebnis ist ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil:
- Strategische Klarheit: Das Unternehmen weiß nun, welche Fähigkeiten es für die Zukunft braucht und wo die kritischsten Lücken klaffen.
- Effizienzsteigerung: Recruiting, Personalentwicklung und Nachfolgeplanung sind zielgerichteter, schneller und kostengünstiger.
- Mitarbeiterbindung: Mitarbeiter sehen klare Karrierepfade, erhalten passgenaue Entwicklungsmöglichkeiten und fühlen sich fair und transparent behandelt.
- Agilität & Zukunftsfähigkeit: Das Unternehmen kann schneller auf Marktveränderungen reagieren, weil es seine internen Ressourcen kennt und flexibel einsetzen kann.
Die MedTech GmbH hat den Nebel gelichtet. Sie hat ihr wichtigstes Kapital – die Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Mitarbeiter – transparent und steuerbar gemacht. Damit hat sie nicht nur ihre aktuellen Probleme gelöst, sondern das Fundament für nachhaltigen Erfolg in einer sich ständig wandelnden Welt geschaffen. Der Abschied vom Bauchgefühl war keine Ausgabe, sondern die beste Investition in die eigene Zukunft.
Literaturverzeichnis
Bartram, D. (2005). The great eight competencies: A criterion-centric approach to validation. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1185–1203. https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1185
Europäische Kommission. (n.d.). ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Abgerufen von https://esco.ec.europa.eu/de
Kauffeld, S., & Paulsen, H. (2018). Kompetenzmanagement in Unternehmen. Kompetenzen beschreiben, messen, entwickeln und nutzen. Stuttgart: Kohlhammer.
Shippmann, J. S., Ash, R. A., Battista, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B., … & Sanchez, J. I. (2000). The practice of competency modeling. Personnel Psychology, 53(3), 703–740. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2000.tb00220.x
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. New York, NY: John Wiley u. Sons.
U.S. Department of Labor. (n.d.). ONET OnLine*. Abgerufen von https://www.onetonline.org/
Workday. (2025). The Global State of Skills. Workday, Inc. https://forms.workday.com/en-gb/reports/the-global-state-of-skills-report/form.html