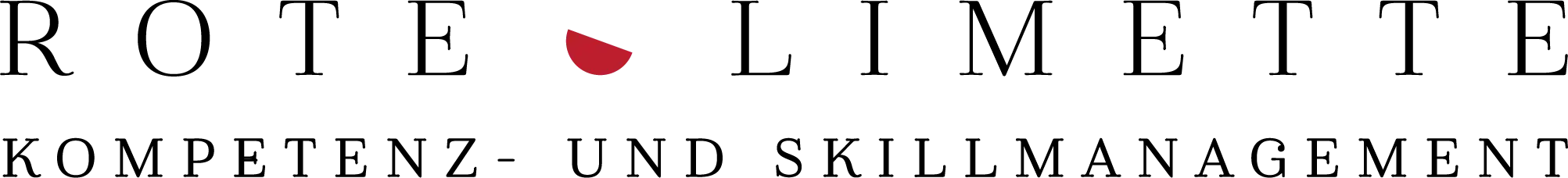Wie Kompetenz- und Skillmodelle die analytische Stellenbewertung beeinflussen
Seit das Genfer Schema 1950 den Grundstein legte, ist das Management von Kompetenzen und Skills untrennbar mit der analytischen Stellenbewertung verbunden. Heute, im Zeitalter der Entgelttransparenz und agiler Arbeitswelten, erleben diese Modelle eine Renaissance. Sie sind der Schlüssel zu einer fairen, transparenten und zukunftsfähigen Vergütungsstruktur. Dieser Artikel beleuchtet die historische Entwicklung, die aktuelle Relevanz und die praktische Anwendung von Kompetenzmodellen in der modernen Stellenbewertung.
Von Genf bis heute: Eine kurze Geschichte der analytischen Stellenbewertung
Die analytische Stellenbewertung hat ihre Wurzeln im Genfer Schema von 1950, das von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ins Leben gerufen wurde. Es war ein Meilenstein, der erstmals eine systematische und nachvollziehbare Bewertung von Arbeit auf Basis von vier zentralen Anforderungsarten ermöglichte:
- Geistige Anforderungen (Fachwissen, Denkvermögen)
- Körperliche Anforderungen (Geschicklichkeit, Muskelbelastung)
- Verantwortung (für Betriebsmittel, Sicherheit, etc.)
- Arbeitsbedingungen (Lärm, Schmutz, Hitze, etc.)
Dieses Schema legte den Grundstein für eine Vielzahl von Bewertungssystemen, die in den folgenden Jahrzehnten entwickelt wurden, wie beispielsweise ERA (Entgelt-Rahmenabkommen) oder die Methoden von Korn Ferry/Hay Group und Mercer. Sie alle teilen das Grundprinzip der Zerlegung von Arbeit in bewertbare Faktoren, um eine objektive Vergleichbarkeit herzustellen.
Das Entgelttransparenzgesetz: Katalysator für eine neue Bewertungspraxis
Das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) von 2017 und die nochmals verschärfte EU-Entgelttransparenzrichtlinie (RL (EU) 2023/970), die bis 2026 in deutsches Recht umgesetzt sein muss, haben die analytische Stellenbewertung wieder in den Fokus gerückt. Unternehmen sind nun verpflichtet, nachzuweisen, dass für gleiche oder gleichwertige Arbeit gleiches Entgelt gezahlt wird. Dies erfordert eine transparente und diskriminierungsfreie Bewertung der Tätigkeiten – eine Anforderung, die pauschale, summarische Verfahren nicht erfüllen können.
Die Konsequenz: Viele Unternehmen müssen ihre bestehenden, oft veralteten und intransparenten Bewertungssysteme überarbeiten oder gänzlich neue, analytische Modelle einführen. Und hier kommen moderne Kompetenz- und Skillmodelle ins Spiel.
Die zentrale These: Kompetenzen als Schlüssel zur Zukunft der Stellenbewertung
Gregor Lötsch (2025) trifft den Nagel auf den Kopf: „Wir sehen insbesondere beim Faktor Kompetenzen – im Sinne von Skills – viele Möglichkeiten, die Stellenbewertung im Anschluss mit unternehmensspezifischen und auf die Zukunft ausgerichteten Aspekten anzureichern und mit anderen HR-Instrumenten wie Karriereplanung und Learning & Development zu verknüpfen.„
Diese These verdeutlicht den Paradigmenwechsel: Weg von starren, tätigkeitsbasierten hin zu dynamischen, kompetenzbasierten Bewertungsmodellen. In einer agilen Arbeitswelt, in der sich Aufgaben und Rollen ständig verändern, sind es die übertragbaren Kompetenzen und Skills der Mitarbeitenden, die den wahren Wert für das Unternehmen schaffen.
Das Kompetenzmodell in der Praxis: Ein 5-stufiges, verhaltensverankertes Modell
In Anlehnung an das Genfer Schema und den aktuellen Annex 1 der EU-Richtlinie lässt sich ein modernes, 5-stufiges und verhaltensverankertes Kompetenzmodell für die analytische Stellenbewertung entwickeln. Die folgenden Tabellen zeigen exemplarisch, wie die drei zentralen Faktoren – Kenntnisse (Know-how), zwischenmenschliche Fähigkeiten (Verhalten) und Problemlösung – in der Praxis bewertet werden können.
a) Kenntnisse (Know-how)
| Stufe | Niveaubeschreibung | Verhaltensanker (exemplarisch) |
| 1 | Basiswissen: Verfügt über grundlegende Kenntnisse, die zur Ausführung einfacher, wiederkehrender Aufgaben erforderlich sind. | – Folgt klaren, detaillierten Anweisungen. – Benötigt bei Abweichungen Unterstützung. |
| 2 | Fachwissen: Besitzt fundiertes Wissen in einem klar definierten Fachgebiet und kann Standardaufgaben selbstständig bearbeiten. | – Löst bekannte Probleme eigenständig. – Erkennt und versteht Zusammenhänge im eigenen Aufgabenbereich. |
| 3 | Spezialwissen: Verfügt über tiefgehendes, spezialisiertes Wissen und kann komplexe Aufgaben mit unterschiedlichen Lösungsoptionen bewältigen. | – Analysiert komplexe Sachverhalte und entwickelt eigenständig Lösungen. – Gibt Wissen an andere weiter und leitet sie fachlich an. |
| 4 | Expertenwissen: Ist eine anerkannte Autorität in einem Fachgebiet und kann innovative Lösungen für neuartige, komplexe Problemstellungen entwickeln. | – Setzt neue Standards und entwickelt neue Methoden. – Berät das Management in strategischen Fachfragen. |
| 5 | Strategisches Wissen: Verbindet tiefes Expertenwissen mit einem umfassenden Verständnis für strategische Unternehmenszusammenhänge. | – Antizipiert zukünftige Entwicklungen und leitet daraus strategische Empfehlungen ab. – Beeinflusst die strategische Ausrichtung des Unternehmens maßgeblich. |
b) Zwischenmenschliche Fähigkeiten (Verhalten)
| Stufe | Niveaubeschreibung | Verhaltensanker (exemplarisch) |
| 1 | Grundlegende Interaktion: Kommuniziert grundlegende Informationen klar und verständlich. | – Gibt Informationen präzise und zeitnah weiter. – Zeigt aktives Zuhören. |
| 2 | Kooperation: Arbeitet effektiv im Team, um gemeinsame Ziele zu erreichen. | – Teilt Informationen proaktiv und unterstützt Kollegen. – Nimmt Feedback an und gibt konstruktives Feedback. |
| 3 | Überzeugung: Kann andere von Ideen und Vorschlägen überzeugen und für die eigene Sache gewinnen. | – Argumentiert schlüssig und verständlich. – Geht auf die Bedürfnisse und Argumente anderer ein. |
| 4 | Verhandlung: Führt komplexe Verhandlungen und erzielt Win-Win-Ergebnisse. | – Entwickelt und vertritt klare Verhandlungsstrategien. – Löst Konflikte und Interessensgegensätze konstruktiv. |
| 5 | Inspiration & Führung: Inspiriert und motiviert andere, gemeinsame Visionen zu entwickeln und zu verfolgen. | – Schafft eine Kultur des Vertrauens und der Zusammenarbeit. – Entwickelt und fördert Talente und Potenziale. |
c) Problemlösung
| Stufe | Niveaubeschreibung | Verhaltensanker (exemplarisch) |
| 1 | Strukturierte Problemlösung: Löst bekannte Probleme anhand vordefinierter Regeln und Prozeduren. | – Erkennt und löst Standardprobleme eigenständig. – Hält sich an etablierte Lösungswege. |
| 2 | Analytische Problemlösung: Analysiert Probleme systematisch und identifiziert die zugrundeliegenden Ursachen. | – Zerlegt komplexe Probleme in handhabbare Teile. – Entwickelt und bewertet verschiedene Lösungsoptionen. |
| 3 | Konzeptionelle Problemlösung: Entwickelt kreative und innovative Lösungen für komplexe und neuartige Probleme. | – Denkt über den Tellerrand hinaus und findet unkonventionelle Lösungsansätze. – Entwickelt und implementiert neue Konzepte und Strategien. |
| 4 | Strategische Problemlösung: Löst komplexe, strategische Probleme mit weitreichenden Auswirkungen auf das Unternehmen. | – Antizipiert zukünftige Herausforderungen und entwickelt proaktiv Lösungsstrategien. – Trifft fundierte Entscheidungen unter Unsicherheit. |
| 5 | Visionäre Problemlösung: Definiert und gestaltet die Zukunft des Unternehmens durch die Lösung fundamentaler, strategischer Herausforderungen. | – Entwickelt und kommuniziert eine klare Vision für die Zukunft. – Schafft die Rahmenbedingungen für nachhaltigen Erfolg und Innovation. |
Fiktives Fallbeispiel: Die „Muster GmbH“ auf dem Weg zur Entgelttransparenz
Die Muster GmbH, ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit 920 Mitarbeitern, steht vor der Herausforderung, ihre Vergütungsstruktur im Einklang mit dem Entgelttransparenzgesetz neu zu gestalten. Das bisherige, nicht tarifgebundene System basiert auf einer Mischung aus historisch gewachsenen, nicht-analytischen Eingruppierungen und individuellen Aushandlungen, was zu Intransparenz und potenzieller Ungleichbehandlung führt.
Vorgehen:
- Projekt-Setup: Die HR-Abteilung initiiert ein Projektteam, bestehend aus HR-Experten, Führungskräften aus verschiedenen Bereichen und Mitgliedern des Betriebsrats.
- Entwicklung eines Kompetenzmodells: Das Projektteam entwickelt, basierend auf dem oben dargestellten 5-stufigen Modell, ein unternehmensspezifisches Kompetenz- und Bewertungsmodell.
- Bewertung der Stellen: Alle Stellen im Unternehmen werden anhand des neuen Modells bewertet. Dabei werden die Stelleninhaber und ihre direkten Vorgesetzten in den Prozess einbezogen, um eine hohe Akzeptanz und Validität sicherzustellen.
- Eingruppierung und Gehaltsbänder: Basierend auf den Bewertungsergebnissen werden die Stellen in neue Entgeltgruppen eingruppiert und transparente Gehaltsbänder definiert.
- Kommunikation und Implementierung: Die neue Vergütungsstruktur wird transparent an alle Mitarbeitenden kommuniziert und schrittweise implementiert.
Exemplarische Eingruppierung:
- Industriemechaniker (m/w/d):
- Know-how: Stufe 2 (fundiertes Fachwissen in der Montage und Wartung von Maschinen)
- Verhalten: Stufe 2 (effektive Zusammenarbeit im Team)
- Problemlösung: Stufe 2 (systematische Analyse und Behebung von technischen Störungen)
- Controller (m/w/d):
- Know-how: Stufe 3 (tiefgehendes Spezialwissen in den Bereichen Controlling und Finanzen)
- Verhalten: Stufe 3 (Überzeugung von Fachbereichen und Management von der Notwendigkeit von Maßnahmen)
- Problemlösung: Stufe 3 (Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Kostenstruktur und Profitabilität)
Durch diesen Prozess schafft die Muster GmbH eine transparente, faire und nachvollziehbare Vergütungsstruktur, die nicht nur den gesetzlichen Anforderungen genügt, sondern auch die Motivation und Bindung der Mitarbeitenden stärkt.
Fazit: Die Zukunft der Stellenbewertung ist analytisch und kompetenzbasiert.
Die analytische Stellenbewertung auf Basis von Kompetenz- und Skillmodellen ist mehr als nur eine Methode zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Sie ist ein strategisches Instrument, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre wertvollste Ressource – die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden – systematisch zu erfassen, zu bewerten und zu entwickeln.
Stärken:
- Transparenz und Fairness: Schaffung einer nachvollziehbaren und diskriminierungsfreien Vergütungsstruktur.
- Zukunftsfähigkeit: Ausrichtung der Bewertung an den für den Unternehmenserfolg relevanten Kompetenzen und Skills.
- Strategische Verknüpfung: Enge Verzahnung mit anderen HR-Instrumenten wie Karriereplanung, Personalentwicklung und Recruiting.
Herausforderungen:
- Implementierungsaufwand: Die Entwicklung und Einführung eines analytischen Bewertungssystems erfordert Zeit und Ressourcen.
- Akzeptanz: Der Erfolg des neuen Systems hängt maßgeblich von der Akzeptanz bei Führungskräften und Mitarbeitenden ab.
Für die praktische Personalarbeit in deutschen Unternehmen bedeutet dies: Die Zeit der intransparenten und subjektiven Gehaltsfindung ist vorbei. Die Zukunft gehört analytischen, kompetenzbasierten Stellenbewertungssystemen, die Fairness, Transparenz und strategische Ausrichtung miteinander verbinden.
Literaturverzeichnis
Wikipedia. (2023). Genfer Schema. Abgerufen am 20. August 2025, von https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Schema
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). (2019). Bericht der Bundesregierung zur Wirksamkeit des Gesetzes zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern. Abgerufen am 20. August 2025, von https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/137224/79c7431772c314367059abc8a3242a55/bericht-der-br-foerderung-entgelttransparenz-data.pdf
Europäische Union. (2023). Richtlinie (EU) 2023/970 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen. Abgerufen am 20. August 2025, von https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L0970
Gabler Wirtschaftslexikon. (o. D.). Genfer Schema. Abgerufen am 20. August 2025, von https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/genfer-schema-32895
Gehalt.de. (o. D.). Analytische Stellenbewertung. Abgerufen am 20. August 2025, von https://www.gehalt.de/arbeit/analytische-stellenbewertung
Lötsch, G. (2025). Unternehmen haben die Chance auf eine individuelle Vergütungsgestaltung. COMP & BEN, 4, 14-17. Abgerufen am 20. August 2025, von https://www.personalwirtschaft.de/wp-content/uploads/2025/08/HR_Comp_Ben_Ausgabe04_2025_Magazin-L.pdf